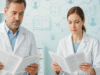Rx-Marketing: Wozu braucht man noch qualitative Arztbefragungen?

© pharma‑insight / bearbeitet mit KI (Collage)
Die Digitalisierung bietet Pharmaunternehmen eine Fülle an Messdaten und Dashboards. Doch moderne Analysen allein können den persönlichen Austausch mit Ärztinnen und Ärzten nicht ersetzen. Michelle Kühn‑Kaczich, Senior Research Director bei der Marktforschungsagentur pharma‑insight GmbH, über den Stellenwert von qualitativen und quantitativen Befragungen im Rx‑Marketing.
Shortread
Qualitative Befragungen bieten tiefe Einblicke in Motive und Emotionen und eignen sich, um neue Fragestellungen zu entwickeln und den Wert von Marketingkanälen zu verstehen. Quantitative Befragungen dagegen liefern robuste Zahlen und ermöglichen Marktforschungsprognosen. Die Kombination beider Ansätze sorgt dafür, dass Pharmaunternehmen das „Warum“ hinter den Zahlen verstehen und Strategien im Rx‑Marketing fundiert planen können. Michelle Kühn‑Kaczich, Senior Research Director bei der unabhängigen Marktforschungsagentur pharma‑insight GmbH (Teil der M3 Gruppe), erläutert im Interview die Hintergründe.
Health Relations:Was sagen Sie zu der Aussage: „Was das Dashboard nicht weiß, existiert nicht in der Wahrnehmung“? Stimmt das?
Michelle Kühn‑Kaczich:Jein. Dashboards liefern schnelle, standardisierte Informationen, aber sie können nicht alles abbilden. Gerade in der qualitativen Marktforschung werden Empathie, Nuancen und zwischen den Zeilen geäußerte Stimmungen sichtbar. Diese persönliche Ebene geht in einem automatisierten Bericht leicht verloren. Deshalb ist es wichtig, quantitative und qualitative Daten miteinander zu kombinieren.
Health Relations:Kundinnen und Kunden wollen häufig messbare Ergebnisse. Spielt das Dashboard im Marketing nicht gerade hier seine Stärken aus?
Michelle Kühn‑Kaczich: Der Wunsch nach messbaren Daten ist groß. Dashboards helfen, Ergebnisse schnell zu verdauen und zu teilen. Doch oft stellen Kundinnen und Kunden die Frage „Warum?“ Wenn es um Motive, Gefühle oder unausgesprochene Einflüsse geht, stößt das Dashboard an Grenzen. Kundinnen und Kunden wollen verstehen, wie Ärztinnen und Ärzte ticken. Das lässt sich nur durch die Kombination beider Methoden erfassen.
Health Relations: Im ärztlichen Umfeld gibt es viele Fachrichtungen. Wie wirkt sich das auf die Forschung aus?
Michelle Kühn‑Kaczich: Die Bedürfnisse variieren stark. Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner decken eine breitere Indikationspalette ab als Onkologinnen und Onkologen und erhalten entsprechend viele Informationen. Onkologinnen und Onkologen arbeiten hingegen mit einem hohen Maß an Komplexität. Jede Therapieentscheidung erfordert eine präzise Abwägung zahlreicher medizinischer Faktoren. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, welche Inhalte für die jeweilige Zielgruppe relevant sind. Es gibt keinen universellen Ansatz. Die Kommunikationskanäle müssen je nach Fachgebiet, Erfahrung und persönlicher Präferenz angepasst werden.
„Wir stellen immer wieder fest, dass Interviews in Teststudios von großem Wert für die Kundinnen und Kunden sind: Sie ermöglichen dem Auftraggeber, seine Zielgruppen direkt und unvermittelt zu erleben.“
Health Relations:Welche Themen werden in quantitativen Befragungen abgefragt?
Michelle Kühn‑Kaczich: Das Spektrum ist groß. Es reicht von klassischen Trackings wie Message Recall und Awareness‑Studien über Wettbewerbsanalysen bis hin zu Ad‑hoc‑Tests für Anzeigen. Wir messen, welche Botschaften der Außendienst übermittelt hat, wie bekannt ein Produkt ist und wie es im Vergleich zum Wettbewerb wahrgenommen wird. Auch Anzeigentests für Fachzeitschriften oder Online‑Publikationen gehören dazu. Grundsätzlich gibt es kaum Fragestellungen, die sich nicht mit Marktforschung beantworten lassen.
Health Relations:Und welche Fragestellungen bearbeiten Sie qualitativ im Rx‑Bereich?
Michelle Kühn‑Kaczich:Ein zentrales Thema ist die Patient Journey – aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte sowie aus Patientinnen‑ und Patientenperspektive. Wir wollen verstehen, welche Wege die Patientinnen und Patienten durchlaufen, welche Stakeholder beteiligt sind und wer letztlich entscheidet. Darüber hinaus gibt es Gesprächslabore, um Gesprächssituationen im Außendienst zu testen, Anzeigentests und Deep‑Insight‑Studien. Bei aktuellen Themen wie dem „Rote‑Hand‑Brief“ können kurze, virtuelle Interviews schnell Stimmungen einfangen. Qualitative Forschung liefert die Grundlage, um Treiber und Hürden einer Therapie zu identifizieren, bevor diese Erkenntnisse bei Bedarf quantifiziert werden.
„Viele Ärztinnen und Ärzte haben klare Vorstellungen davon, wie sie informiert werden möchten.“
Health Relations: Gab es schon unerwartete Erkenntnisse aus qualitativen Befragungen?
Michelle Kühn‑Kaczich: Ja, zum Beispiel hinsichtlich des Außendienstes. Letztens hatte ich eine Studie mit Kundinnen und Kunden, die vermutet haben, dass persönliche Besuche in Zeiten der Digitalisierung an Bedeutung verlieren. Die Ärztinnen und Ärzte berichten jedoch oft, dass sie den persönlichen Außendienst während der Pandemie vermisst haben und dass dieser Kanal wichtig bleibt. Wir stellen immer wieder fest, dass Interviews in Teststudios von großem Wert für die Kundinnen und Kunden sind: Sie ermöglichen dem Auftraggeber, seine Zielgruppen direkt und unvermittelt zu erleben. Der persönliche Eindruck vor Ort vermittelt dabei oft deutlich mehr Nuancen als ein reiner Webstream. Teststudios machen Zielgruppen erlebbar. Hier sieht man Reaktionen, spürt Stimmungen und versteht Bedürfnisse viel direkter als online. Nur im direkten Gespräch lassen sich Beziehungen aufbauen, die in einem Dashboard nicht sichtbar sind.
Health Relations: Wie relevant sind Printmedien, Fachzeitschriften und persönliche Netzwerke?
Michelle Kühn‑Kaczich:Sie spielen weiterhin eine wichtige Rolle. Ältere Kolleginnen und Kollegen bevorzugen oft Print und schätzen den persönlichen Austausch, etwa bei Gruppendiskussionen oder Workshops. Quantitativ lässt sich messen, über welche Kanäle Ärztinnen und Ärzte Informationen beziehen und wofür genau, qualitativ fragen wir zum Schluss nach, welche Kontaktpunkte wichtig sind, welche sie empfehlen und warum genau. Viele Ärztinnen und Ärzte haben klare Vorstellungen davon, wie sie informiert werden möchten.
„Oft überrascht, dass Chatbot‑Lösungen nicht günstiger sind als Interviewer; sie erfordern viel Vorarbeit und sind nicht zwangsläufig schneller.“
Health Relations:Können qualitative Studien skalierbar sein? Viele Kundinnen und Kunden wollen Ergebnisse quantifizieren.
Michelle Kühn‑Kaczich:Die Nachfrage steigt. Früher umfassten qualitative Studien fünf bis acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer, heute sind 20 Personen und mehr üblich, um Tendenzen abzuleiten. Wir weisen dennoch auf die kleine Stichprobe hin; für robuste Aussagen braucht es mehr quantitativen Input. In manchen Fällen ist ein modularer Ansatz sinnvoll: qualitativ starten, Fragen identifizieren und anschließend quantifizieren. Die Auswahl hängt vom Erkenntnisinteresse ab. Für ein Markt‑Forecast sind quantitative Stichproben notwendig, für ein Gesprächslabor empfiehlt sich qualitativ.
Health Relations: Qualitative Elemente halten zunehmend Einzug in Online‑Befragungen, etwa durch Chatbots, die nachfragen. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Michelle Kühn‑Kaczich: Wir beobachten mehr offene Fragen in quantitativen Umfragen. Mithilfe von KI lässt sich näher nachhaken, doch das ist teuer und erfordert eine genaue Definition der Nachfragen. Oft überrascht, dass Chatbot‑Lösungen nicht günstiger sind als Interviewer; sie erfordern viel Vorarbeit und sind nicht zwangsläufig schneller. Beim Message Recall können Nachfragen nützlich sein, aber jede Zusatzfrage beeinflusst die Erinnerung und damit die Ergebnisse. Wir wägen gemeinsam mit Kundinnen und Kunden ab, wie tief Nachfragen gehen sollen und ob KI-Lösungen für das Ziel der Studie einen Mehrwert und weitere Insights bringen.
Health Relations: Wie sähe für Sie ein ideales Dashboard aus?
Michelle Kühn‑Kaczich:Dashboards werden sehr unterschiedlich definiert. Für uns gehören Filtermöglichkeiten für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte oder Klinikärztinnen und Klinikärzte und Word‑Clouds für offene Fragen zu den Grundanforderungen. Der beste Mix ist ein Live‑Report, der zeigt, was im Feld passiert, und der das Clustern nach Zielgruppen je Frage ermöglicht und dies übersichtlich darstellt.
Health Relations: Was motiviert Ärztinnen und Ärzte, 75‑minütige qualitative Interviews zu führen?
Michelle Kühn‑Kaczich:Entscheidender Anreiz ist das Thema. Wenn ein neues Produkt oder eine Pipeline vorgestellt wird, erfahren Ärztinnen und Ärzte Neuigkeiten aus erster Hand. In Einzelinterviews möchten sie ihr Expertenwissen teilen, im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen neue Perspektiven hören. Gruppendiskussionen ermöglichen Networking. Zwar gibt es finanzielle Anreize, doch die meisten nehmen teil, weil sie ihr Fachwissen teilen können. Quantitative Befragungen lassen sich flexibler in den Alltag integrieren, aber qualitative Interviews werden häufig als bereichernder empfunden.
Health Relations: Wie vermeiden Sie Bias in qualitativen Befragungen, wenn nur wenige Personen teilnehmen?
Michelle Kühn‑Kaczich: Natürlich ist die Fallzahl in qualitativen Befragungen begrenzt. Deshalb legen wir großen Wert auf eine sorgfältige Auswahl der Gesprächspartner und eine neutrale Gesprächsführung. Wir arbeiten mit Screening‑Fragen und Quoten, etwa für Nutzer und Nichtnutzer eines Produkts sowie für eine regionale Verteilung. Zusätzlich berücksichtigen wir Einstellungen zu bestimmten Substanzklassen, um einen ausgewogenen Mix zu gewährleisten. Die Rekrutierung erfolgt durch unser eigenes Field‑Department, nicht online.
„Qualitative und quantitative Forschung ergänzen sich und werden im Pharmamarketing ihren Stellenwert behalten.“
Health Relations: Sie sagen, beide Methoden haben ihren Platz.
Michelle Kühn‑Kaczich:Absolut. Viele Unternehmen entscheiden sich für das eine oder andere; wir bieten bewusst beides an. Häufig starten wir qualitativ, um Hypothesen zu entwickeln, und quantifizieren im Anschluss. Umgekehrt können Tracking‑Studien qualitative Nachfragen nutzen, um das „Warum“ zu klären. Qualitative und quantitative Forschung ergänzen sich und werden im Pharmamarketing ihren Stellenwert behalten.
Health Relations: Pharmaunternehmen selbst sitzen inzwischen auf riesigen Datensätzen. Reicht das nicht aus, um Marktforschung zu betreiben?
Michelle Kühn‑Kaczich:Sie verfügen über viele interne und externe Daten, aber oft wissen sie nicht, wie sie alles zusammenführen sollen. Zudem wird hinterfragt, wie neutral Ergebnisse sind, wenn sie ausschließlich intern erhoben werden. Wir empfehlen deshalb, neben eigenen Kundinnen‑ und Kundenlisten auch Panel‑Teilnehmerinnen und Panel‑Teilnehmer zu rekrutieren. Eine unabhängige Perspektive schafft Vertrauen und liefert zusätzliche Zielgruppen.
Qualitative vs. quantitative Befragungen
| QUALITATIVE BEFRAGUNG | QUANTITATIVE BEFRAGUNG | |
| Teilnehmerzahl | Kleinere Stichproben, meist 10–20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Projekt. | Größere Stichproben (mind. 50 Ärztinnen und Ärzte), um repräsentative Marktprognosen zu ermöglichen. |
| Methoden | Tiefgehende Interviews, Fokusgruppen und Gesprächslabore. Eine Moderatorin oder ein Moderator kann individuell nachfragen und Stimmungen einfangen. | Standardisierte Fragebögen, Online‑Umfragen oder telefonische Befragungen (CATI). Geschlossene und zunehmend auch offene Fragen. |
| Ziel | Verständnis für Motive, Treiber, Hürden und Emotionen gewinnen; Entwicklung von Hypothesen. | Messung von Awareness, Image, Marktanteilen und Wirksamkeit von Botschaften; Bestätigung von Hypothesen. |
| Vorteile | Flexibel, ermöglicht spontane Nachfragen; liefert Kontext und ermöglicht persönliches Erleben (auf Kundenseite). | Schnelle, skalierbare Ergebnisse; erleichtert den Vergleich zwischen Zielgruppen und Wettbewerbern. |
| Grenzen | Kleine Stichproben limitieren die Verallgemeinerbarkeit; Ergebnisse zeigen Tendenzen, aber keine statistische Signifikanz. | Standardisierung erschwert Nachfragen; Antworten können oberflächlich bleiben; das „Warum“ bleibt oft offen. |