J&J Open House: Genug gejammert!
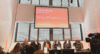
© Regine Marxen
Auf dem J&J Open House Ende Juni 2025 in Berlin diskutierten Expertinnen und Experten aus Politik, Forschung, Industrie und Versorgung über das Gesundheitswesen der Zukunft. Ein gemeinsamer Nenner: Fortschritt braucht ein neues, positives Narrativ. Denn ein negatives Mindset kann ein Bremsklotz für Innovationen sein.
J&J Open House 2025
Prof. Sylvia Thun (Charité BIH), Dr. Ruth Hecker (Aktionsbündnis Patientensicherheit), Prof. Dennis Ostwald (WifOR Institute), Christian Gräff (CDU) und Urs Voegeli (Johnson & Johnson) diskutierten beim J&J Open House in Berlin (im Rahmen des Hauptstadtkongressses), wie das Gesundheitswesen zukunftsfähig gestaltet werden kann. Der interdisziplinäre Dialog offenbarte: Es mangelt vielfach an Kommunikation über den Nutzen von Innovationen. Gefordert wurden ein positives Narrativ, mehr Datenkompetenz, wirtschaftlich orientierte Argumentationen und patientenverständliche Sprache. Kommunikation müsse Vertrauen schaffen, Beteiligung ermöglichen und politische wie gesellschaftliche Entscheidungen flankieren.
Als Urs Voegeli aus Australien nach Deutschland zurückkehrte, fiel ihm eines besonders auf: „Der Außenblick auf Deutschland ist viel, viel besser als der pessimistische Innenblick, das ist unglaublich. Deutschland steht immer noch für Innovation, für Präzision.“ Vögeli, seit August 2024 Managing Director von Johnson & Johnson Innovative Medicine Deutschland und zuvor u.a. als Area Director für J&J in Australien und Neuseeland aktiv, eröffnete das J&J Open House am Rande des Hauptstadtkongresses 2025 in Berlin mit einem Appell für konstruktiven Dialog. „Wir müssen Plattformen schaffen, auf der wir uns austauschen – es darf durchaus diskursiv sein – aber am Ende des Tages müssen wir uns dann auch einigen. Auf Priorität und auf den Plan, wie wir es gemeinsam umsetzen.“ Denn, fügte er hinzu, „alleine schafft das niemand.“
„Mindset ist unglaublich wichtig, wir müssen positiver werden“
Urs Voegeli sieht in Haltung und Ton in der Gesundheitskommunikation ein enormes Wirkungspotential. Kommunikation sollte Verantwortung übernehmen – und den Fokus auf Lösungen und Fortschritt legen. Das bedeutet nicht, Probleme zu verschweigen, sondern sie mit einem lösungsorientierten Narrativ zu kontextualisieren. Heißt: Statt Innovationen primär unter dem Blickwinkel der Kosten zu verhandeln, sollten ihre Beiträge zu Versorgung, Lebensqualität, Arbeitsfähigkeit und wirtschaftlicher Stabilität aktiv kommuniziert werden – in klarer, evidenzgestützter Sprache. Denn Akzeptanz für Veränderungen entstehe nur, wenn die Menschen ihren Mehrwert verstehen. „Innovation muss als Investition verstanden werden.“ Dieser Perspektivwechsel betrifft auch seine eigene Branche, die Pharmaindustrie. Wer Innovationen entwickle, müsse deren Nutzen klar vermitteln können – nicht nur regulatorisch, sondern auch kommunikativ: gegenüber Kassen, Ärztinnen und Ärzten sowie Patientinnen und Patienten.
„Wir müssen klug in Innovationen investieren“
Für Prof. Dennis Ostwald vom WifOR Institute ist Gesundheit nicht nur ein sozialpolitisches, sondern auch ein makroökonomisches Thema. Gesundheit sei längst kein Kostenfaktor mehr, sondern Wachstumsmotor: „12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist durch die Gesundheitsausgaben realisiert, 18 Prozent der Beschäftigten arbeiten in dem Sektor, 10 Prozent der Exporte werden durch den Sektor erwirtschaftet.“ Es brauche klare Kommunikationsstrategien, die genau das auch widerspiegeln: „Wir müssen klug in Innovationen investieren, wir müssen dann messen, was bringt das eigentlich an Humankapazitäten, an gesunder Bevölkerung.“ Auch der CDU-Abgeordnete Christian Gräff ist überzeugt von der Wirtschaftskraft des Gesundheitssektors in Deutschland. Die sei „in der Tat eine Riesenchance ist für Deutschland, wenn wir unsere Risikoaffinität da ein bisschen ablegen.“
„Gesundheit ist unser höchstes Gut“ – aber kein zentrales Narrativ
Dr. med. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, sprach Klartext: „Gesundheit ist unser höchstes Gut und das müssen wir uns alle immer wieder vergegenwärtigen und das tun wir, glaube ich, zu wenig.“ Das System sei zersplittert und von Eigeninteressen geprägt: „Wir sind zu sehr sektoriert.“ Zentrale Kritik: mangelnde Transparenz, wenig Mut – und eine Kommunikation, die Ängste statt Lösungen betone. Die Debatte über Versorgung werde häufig mit Begriffen geführt, die eher verunsicherten als aufklärten. Ein Beispiel: „Patientensteuerung – wer will sich schon steuern lassen? Also ich steuere mein Auto – noch, aber ich will doch nicht gesteuert werden.“ Hecker plädierte daher für eine neue Sprache in der Gesundheitskommunikation – weniger technokratisch, stärker nutzerzentriert. Der Nutzen von Versorgungslösungen wie elektronischer Patientenakte, sektorenübergreifender Versorgung oder datenbasierter Qualitätssicherung müsse so vermittelt werden, dass Patientinnen und Patienten sie in ihrem Alltag verstehen und einordnen können. Die zentrale Frage in ihren Augen: Welche Sprache, welche Kanäle und welche Inhalte erreichen die Bevölkerung – und bauen Vertrauen in notwendige Veränderungen auf? Patientinnen und Patienten seien heute informierter und dialogbereiter denn je. Initiativen wie die Nationale Dekade gegen Krebs hätten gezeigt, dass Patientinnen und Patienten bereit seien, Verantwortung zu übernehmen – etwa bei Studienentscheidungen. Die Kommunikation müsse darauf ausgerichtet sein, Beteiligung zu ermöglichen – nicht zu verhindern.
„Im Gesundheitswesen besser schulen“
Fakten, die auch entsprechend kommuniziert werden, würden das gesamtgesellschaftliche Vertrauen in das wirtschaftliche Potenzial der Branche und in deren Innovationskraft fördern. Denn genau daran mangele es, so Prof. Dr. Sylvia Thun, Medizininformatikerin an der Charité. In ihren Augen braucht es ein positives Narrativ, das genau diese Stärken betont. „Wir sind Weltmeister in der Forschungsdateninfrastruktur, die jetzt auch von Pharma genutzt werden kann.“ Ihr Appell: mehr Datenkompetenz, weniger Angst. „Wir müssen mehr Daten sammeln und datengesteuerte Medizin einführen. Und wir müssen dementsprechend die jungen Menschen, aber auch alle anderen Menschen im Gesundheitswesen besser schulen, also Health Data Literacy fördern.“
Fazit: Kommunikation ist Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit
Das J&J Open House machte vor allem eines deutlich: Die Debatten um Versorgung, Daten, Digitalisierung und Finanzierung sind komplex – doch ohne ein strategisch durchdachtes Narrativ bleiben viele Innovationen folgenlos. Es mangelt nicht an Expertise, Lösungen und Erfolgen – wohl aber an Klarheit in der Kommunikation. Kurz: Das Jammern muss ein Ende haben. Aber dafür muss ein neuer Kommunikationsrahmen entstehen. Einer, der Patientinnen, Patienten, Healthcare Professionals und Stakeholder mitnimmt, der politische Entscheidungsprozesse unterstützt, wirtschaftliche Argumente sichtbar macht. Und der Fortschritt verständlich erklärt. Hier sind alle Beteiligten, auch die Pharmaindustrie gefragt.
J&J Open House, Juni 2025: Hier geht’s zur Videoaufzeichnung
Um diesen Inhalt von YouTube anzuzeigen, müssen Sie ihn entsperren. Dabei werden Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenFAQ: J&J Open House 2025
Was ist das J&J Open House?
Das J&J Open House ist eine Veranstaltungsreihe von Johnson & Johnson, die Expertinnen und Experten aus Politik, Forschung, Versorgung und Industrie zusammenbringt, um zentrale Zukunftsfragen des Gesundheitswesens zu diskutieren.
Was wurde beim J&J Open House 2025 in Berlin diskutiert?
Im Mittelpunkt standen Themen wie Datenkompetenz, sektorübergreifende Versorgung, Investitionen in Innovationen sowie die Rolle einer konstruktiven Kommunikation. Die Diskussion lenkte den Blick von Barrieren hin zu Lösungen und bestehende Fortschritten.
Warum ist Kommunikation im Gesundheitswesen so wichtig?
Dr. Ruth Hecker betonte, dass Sprache im Gesundheitskontext häufig verunsichere statt zu informieren. Begriffe wie „Patientensteuerung“ seien abschreckend. Kommunikation müsse stattdessen Vertrauen schaffen, Ängste abbauen und den Nutzen von Innovationen klar vermitteln – verständlich, transparent und patientenorientiert.
Welche Rolle spielt Datenkompetenz in der Gesundheitsversorgung?
Prof. Sylvia Thun hob hervor, dass Deutschland über eine herausragende Forschungsdateninfrastruktur verfüge. Gleichzeitig forderte sie mehr Health Data Literacy, also Datenkompetenz bei allen Beteiligten im Gesundheitswesen.
Was versteht Urs Vögeli unter einem positiven Mindset in der Gesundheitskommunikation?
Vögeli betonte, wie entscheidend Haltung und Sprache für Innovationsakzeptanz sind. Kommunikation solle Lösungen sichtbar machen – nicht nur Probleme. Innovationen müssten als Investitionen verstanden und vermittelt werden – gegenüber Patientinnen und Patienten, Fachkreisen und Entscheidungstragenden.
Was ist das Fazit des J&J Open House 2025?
Fortschritt im Gesundheitswesen braucht nicht nur technische und organisatorische Innovationen, sondern auch ein neues, gemeinsames Narrativ. Kommunikation wird dabei zur Schlüsselressource – um Veränderungen zu erklären, Vertrauen aufzubauen und den Beitrag der Gesundheitswirtschaft sichtbar zu machen.
Disclaimer: Die FAQ-Fragen wurden mit einer KI generiert.

