Seltene Erkrankungen – wann ist Pharmakommunikation wirklich relevant?
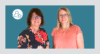
© PINK CARROTS Communications (KI-bearbeitet)
Seltene Erkrankungen stellen alle Beteiligten des Gesundheitssystems vor besondere Herausforderungen – von der Entwicklung neuer Medikamente über die sichere Diagnose bis zur Wahl der passenden Therapie. Zielgerichtete Pharmakommunikation kann einen Beitrag leisten, um die Situation Betroffener zu verbessern. Wie der genau aussehen kann, erläutern Vanessa Schneider, Executive Client Service Director, und Dr. Britta Unruhe-Knauf, Director Medical, von PINK CARROTS.
Laut aktuellen Schätzungen gibt es derzeit ca. 8.000 bekannte seltene Erkrankungen. Eine Krankheit gilt in der EU als selten, wenn die Prävalenz unter 5 von 10.000 liegt. Trotz der Seltenheit der einzelnen Erkrankung ist die Gesamtzahl der Betroffenen hoch – allein in Deutschland liegt sie bei ca. vier Millionen Menschen. Für die Patient:innen sind seltene Erkrankungen oft mit einem langen Leidensweg verbunden, der von zahlreichen Arztbesuchen, Fehldiagnosen und Therapieversuchen geprägt ist. Denn auch Ärzt:innen fehlt häufig das Wissen oder die Erfahrung, wenn es darum geht, besonders seltene und komplexe Krankheitsbilder richtig zu erkennen und zu behandeln. Hinzu kommt, dass nur für ca. 2 % der seltenen Erkrankungen eine kausale Therapie zur Verfügung steht.
Pharmazeutische Unternehmen stehen nicht nur bei der Erforschung, Entwicklung und Zulassung von Medikamenten gegen seltene Erkrankungen (Orphan Drugs) vor einer Herausforderung. Auch die Kommunikation muss hohe Anforderungen erfüllen. Grundsätzlich geht es darum, die Zielgruppen – allen voran Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner, Fachärztinnen und -ärzte sowie Patientinnen und Patienten – über komplexe Krankheitsbilder aufzuklären. Doch ihr Wissensstand und ihre Bedürfnisse unterscheiden sich deutlich voneinander. Das heißt: Eine relevante und glaubwürdige Kommunikation über Orphan Drugs setzt eine differenzierte, gut durchdachte Ansprache voraus. Und hier gilt, dass gut gemeint nicht immer gut gemacht ist.
Wie kann man die Kernzielgruppen kommunikativ am besten erreichen?
1. Allgemeinmediziner – die erste Anlaufstelle
Hausärztinnen und -ärzte sind oft die ersten medizinischen Anlaufstellen für Betroffene. Sie müssen die oft unspezifischen Symptome deuten und in Zusammenhang bringen, um so eine Verdachtsdiagnose einer seltenen Erkrankung zu stellen und gegebenenfalls an Fachkolleginnen und -kollegen zu überweisen. Dabei stehen sie unter großem zeitlichem Druck. Wie können Pharmaunternehmen sie unterstützen?
- Praxisnahe Sensibilisierung: CME-zertifizierte Fortbildungen, Fallbeispiele sowie Informationsmaterialien zu klaren Leitsymptomen können seltene Erkrankungen ins Bewusstsein rücken, ohne zu überfordern. Zu viele Fachtermini und detaillierte Studiendaten sollten vermieden werden, da sie abschreckend wirken.
- Effiziente Tools: Checklisten, kurze Videos oder KI-gestützte Symptomfinder können bei der Verdachtsdiagnose helfen und dem HCP aufwendige Recherchen und damit kostbare Zeit ersparen.
- Einfache Vernetzung: Kontakte zu MSLs, medizinischen Netzwerken oder Expertenzentren sollten angeboten und gefördert werden, damit Hausärztinnen und Hausärzte mit der Herausforderung, eine seltene Erkrankung zu erkennen, nicht allein dastehen.
2. Fachärzte – die Entscheidungsträger im Diagnose- und Therapieverlauf
Fachärztinnen und Fachärzte sind für die differenzialdiagnostische Abklärung und die Therapie seltener Erkrankungen verantwortlich. Sie sind wissenschaftlich interessiert, aber auch kritisch gegenüber werblicher Kommunikation.
Was funktioniert bei ihnen?
- Überzeugende Evidenz: Studienergebnisse, Real-World-Daten, Subgruppenanalysen – bei Fachärztinnen und -ärzten sind wissenschaftliche Daten gefragt, um die Relevanz einer Therapie zu belegen.
- Kommunikation auf Augenhöhe: Die Kommunikation sollte zwar deutlich machen, wie sich ein Medikament in bestehende Leitlinien und Behandlungsalgorithmen einfügt, die Therapieentscheidung trifft der HCP aber letztlich selbst. Ein belehrender oder drängender Tonfall und zu viel Emotionalität sind fehl am Platz.
- Anregender Austausch: Die Einbindung von KOLs und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von Kongressen, Symposien oder Advisory Boards ist nicht nur glaubwürdig, sondern motoviert HCPs, sich näher mit einer Erkrankung zu beschäftigen.
3. Patienten – die Betroffenen und ihre Angehörigen
Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen sind oft stark belastet – körperlich, emotional, sozial. Viele haben einen langen Diagnoseweg hinter sich oder leben noch immer mit einer nicht klar diagnostizierten Krankheit. Sie suchen nach verständlichen Informationen, Orientierung und Gemeinschaft. Gleichzeitig sind sie besonders sensibel für vermeintlich manipulative Aussagen oder unrealistische Versprechen.
Was wünschen sie sich?
- Empathische Ansprache: Inhalte und Tonalität sollten unterstützend und ermutigend sein, dabei aber immer realistisch bleiben, um keine falsche Hoffnung zu wecken. Storytelling – z. B. in Form echter Patientenberichte – kann Vertrauen schaffen, wenn es authentisch und transparent ist.
- Verständliche Aufklärung: Betroffene und Angehörige brauchen klare, verständliche Informationen zu Krankheit, Diagnostik und Therapie. Infografiken, Erklärvideos, Broschüren und Webseiten stellen eine gute Basis dar. Die Kür sind spezielle Patientenunterstützungsprogramme, die neben reinen Informationen über ein Medikament auch weitere Services beinhalten, und darauf abzielen, Therapietreue und Lebensqualität zu verbessern.
- Community fördern: Der Austausch mit anderen Betroffenen über Plattformen, Veranstaltungen oder Selbsthilfegruppen hat für Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige einen hohen Stellenwert. Gut durchdachte Angebote – idealerweise gemeinsam mit Patientenvertretern entwickelt – schaffen Vertrauen und stärken die Patientenbindung.
Fazit: Mit Fingerspitzengefühl und Glaubwürdigkeit
Pharmakommunikation im Bereich der seltenen Erkrankungen erfordert ein besonders hohes Maß an Zielgruppenverständnis, Verantwortung und Glaubwürdigkeit. Maßnahmen sollten bei jeder Zielgruppe den richtigen Ton treffen und nicht nur informieren. Sie sollten dort unterstützen, wo der jeweilige Bedarf der Zielgruppe liegt. Auf diese Weise kann Pharma einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass seltene Erkrankungen früher erkannt und Patientinnen und Patienten besser behandelt werden. Der enge Schulterschluss von pharmazeutischen Unternehmen, Agenturen, HCPs, Patientinnen und Patienten erleichtert dieses Unterfangen enorm. So kann Kommunikation mehr sein als Marketing – sie kann zu einer besseren Versorgung beitragen – und einen echten Mehrwert schaffen.

