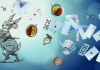In diesem Artikel erfahren Sie:
- Warum bemängeln Ärzt:innen „Datensparsamkeit“?
- Wie digital sind Kliniken aus Sicht einer jungen Ärztin heute aufgestellt?
- Weshalb wirkt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bremsend in der Medizin?
- Wie soll die Digitalisierung in der Ausbildung von Ärzt:innen besser verankert werden?
Keine Frage, die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist noch nicht dort angekommen, wo sie sich viele Befürworter wünschen. DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen) laufen nur schleppend an, das eRezept scheint in einer Dauertestschleife festzustecken. Die Telemedizin hingegen hat durch die Corona-Pandemie einen Aufschwung erlebt. Über zu überwindende Grenzen und Chancen der Digitalisierung in der Medizin diskutierten Vertreter:innen aus der Ärzteschaft Anfang Mai auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM).
Falsch verstandener Datenschutz in der Medizin?

Ein bekannter Schmerzpunkt beim Thema Digitalisierung ist die Datengewinnung bzw. der Datenschutz. Ärztinnen und Ärzte monieren die „Datensparsamkeit“, also das Erfassen nur der unmittelbar notwendigen personenbezogenen Daten und Informationen. „Je umfassender die eingeschlossenen Daten sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, bisher unbekannte Zusammenhänge aufzudecken“, sagt Prof. Dr. Markus M. Lerch, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am LMU Klinikum München und DGIM-Präsident, in einem Pressestatement. Langsamkeit und Zögern bei Digitalisierungsthemen kann mitunter sogar gefährlich sein – etwa, wenn der Notarzt nicht weiß, wie der Facharzt behandelt. „Der Datenschutz kann etwa dazu führen, dass ein Arzt in der Notaufnahme aufgrund einer technischen Zugriffsblockade nicht die Behandlung desselben Patienten durch den Facharzt einsehen kann, da der Notfallmediziner nicht an der ursprünglichen Behandlung beteiligt war.“ Besser sei es, den Zugriff auf die Patientendaten zu dokumentieren und im Falle von Missbrauch zu bestrafen. Ziel des Datenschutzes in der Medizin sollte Lerch zufolge sein, Patienten gegen den Missbrauch ihrer Daten zu schützen, nicht, Ärzt:innen den Zugang zu Daten zu verwehren.
Lerch: DSGVO bremst Wissenschaft bei klinischen Studien
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die Bürger: innen vor dem Zugriff Unbefugter auf ihre Daten schützen soll, scheint mit einer für medizinische Anwendungen zweckmäßigen Nutzung nur schwer oder gar nicht in Einklang zu bringen zu sein. „Der Austausch von Patientendaten zwischen Medizinern kann Menschenleben retten und die Beweggründe sind andere als bei Google, Amazon oder der Schufa. Die DSGVO berücksichtigt diesen Unterschied nicht“, argumentiert Lerch und konstatiert ein „Auslegungsproblem“ der DGSVO in Deutschland. Ein Manko, das auch zulasten der Wissenschaft und der Industrie geht: „Lange Wege im Antragswesen, komplizierte Ausgestaltungen der Datenschutzbestimmungen und seitenlange Unterlagen in klinischen Studien“ halten demnach davon ab, klinische Studien in Deutschland durchzuführen. Deutlich sei dies zuletzt in der Corona-Pandemie geworden: Die entscheidenden Impfstudien („Recovery-Studie“) seien in Großbritannien und nicht in Deutschland durchgeführt worden, da die Studie dort ein deutlich größeres Patientenkollektiv umfasste und kontinuierlich weitere Erkenntnisse geliefert habe. Auch die in Deutschland entwickelte Corona-App sei wegen der datenschutzrechtlichen Bedenken nicht zum „Gamechanger“ geworden. „Obwohl diese App 45 Millionen Mal heruntergeladen worden ist, hat sie überhaupt keinen Unterschied gemacht.“
In deutschen Kliniken wird über Fax kommuniziert

Für die junge Ärzt:innengeneration steht Dr. med. Anahita Fathi, Sprecherin der AG Junge DGIM und Fachärztin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Für sie ist die Digitalisierung mit großen Chancen für eine bessere Patient:innenversorgung verbunden. Die Telemedizin ermöglicht Ärzt:innen, Diagnostik und Befundungen aus der Distanz durchzuführen. Mit KI-basierten Technologien können bessere Entscheidungen getroffen und die Dokumentation von Therapieverläufen optimiert werden. Die Realität sieht vielfach noch anders aus: „In deutschen Kliniken wird vielerorts noch über Fax kommuniziert. Verschlüsselte E-Mail-Systeme sind oft nicht vorhanden, sodass der weitaus schnellere, unkompliziertere und schlichtweg zeitgemäßere Austausch via E-Mail mit Patient:innen und mit unseren Kolleg:innen nicht möglich ist. Das schränkt uns wirklich sehr ein.“ Nicht zuletzt sei der Datenschutz beim Fax zu hinterfragen. Auch sei eine flächendeckende Nutzung der digitalen Patientenakte, wie sie in anderen Ländern bereits Standard ist, in Deutschland noch nicht umgesetzt worden. Untersuchungen würden daher– unnötigerweise – wiederholt. In der Pandemie hätte sich außerdem gezeigt, dass es viele inkompatible digitale Systeme gibt.
Durch die Pandemie wurden jedoch auch digitale Prozesse angestoßen: Ärzt:innen vernetzen sich zunehmend digital mit Kolleg:innen anderer Fachgebiete, telemedizinische Sprechstunden wurden ausgebaut und das Fortbildungsverhalten der Mediziner:innen hat sich verändert: „Viele Fortbildungen für Ärzt:innen sind nun digital verfügbar, das ist ein großer Gewinn und führt zu einer Demokratisierung des Wissens“, so Fathi. So hätten Mediziner:innen an Fortbildungen teilnehmen können, die diese ansonsten aus zeitlichen oder finanziellen Gründen nicht besucht hätten.
Digitalisierung in Ausbildung verankern

Um digitale Prozesse mitgestalten zu können, sollten junge Mediziner:innen bereits in ihrer Ausbildung besser auf die Digitalisierung vorbereitet werden. Dafür spricht sich Professor Dr. med. Georg Ertl, Kardiologe und Generalsekretär der DGIM, aus. Ein digital kompetenter Arzt muss nicht nur Videosprechstunden durchführen und DiGA-Daten nutzen können, er muss beispielsweise auch verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert, der Patient:innendaten auswertet und Therapievorschläge macht. „Wenn wir solche sensiblen Fragestellungen nicht der Industrie überlassen wollen, brauchen wir dafür Ärztinnen und Ärzte mit grundlegenden Kenntnissen der Funktionsweisen.“ Seiner Meinung nach steht die Medizin vor einem Kulturwandel: Arbeitskonzepte aus Wirtschaft, Industrie und IT werden zunehmend das Gesundheitswesen prägen. „Wir brauchen deshalb ärztlich gut aus-, weiter- und fortgebildete ‚Kommunikatoren zwischen Medizin und Informatik‘, die nicht nur die Technologie verstehen, sondern auch über ausreichende klinische Erfahrung verfügen.“
Wird es einen Facharzt für digitale Medizin geben?
Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin hat vor zwei Jahren die „Kommission Digitale Transformation in der Inneren Medizin“ (DTIM) gegründet, die sich u.a. der Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung widmet. Die Fachgesellschaft schlägt eine Zusatz-Weiterbildung „Digitale Medizin“ vor. Ob langfristig auch ein Facharzt für digitale Medizin notwendig wird, werden die nächsten Jahre zeigen, so Ertl. Auszuschließen sei dies nicht.