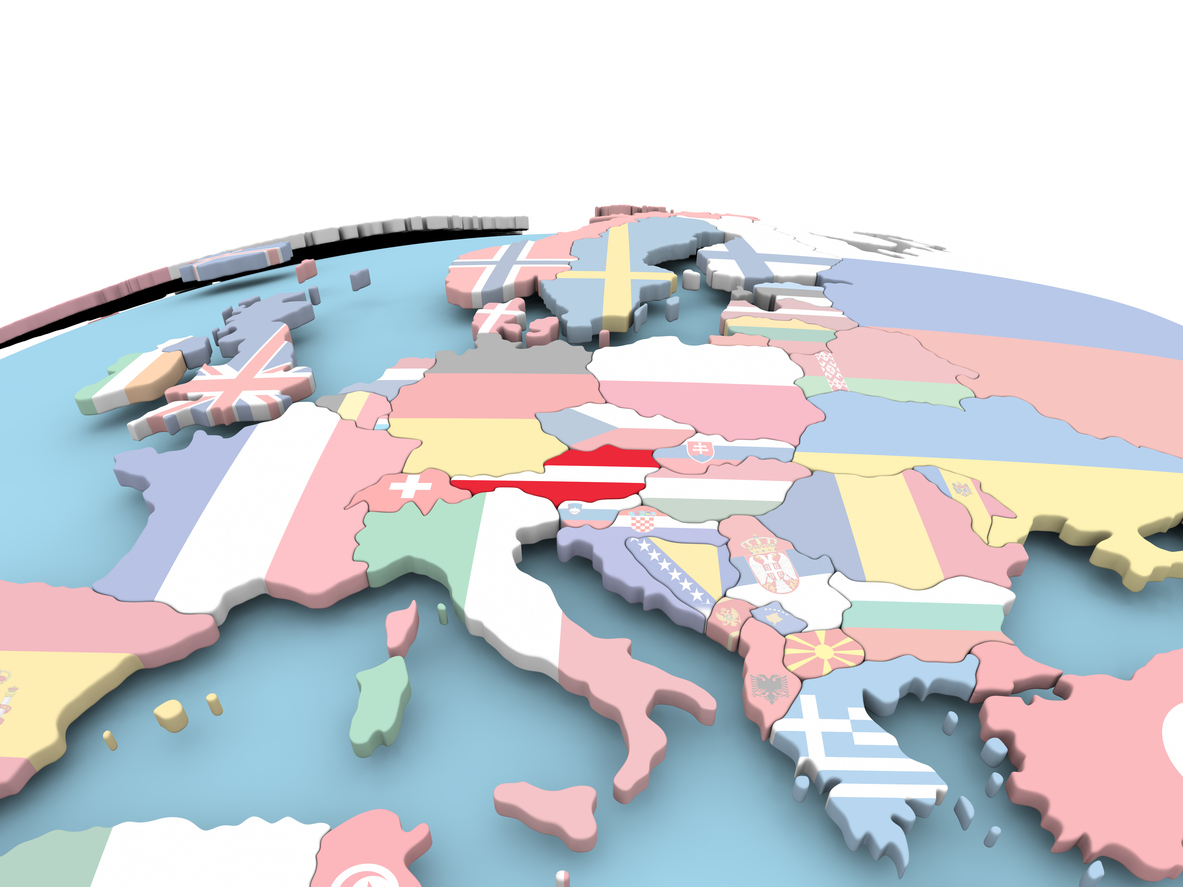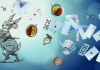Die Europäische Kommission überrascht mit dem Verordnungsentwurf „Directive 2011/24/EU“. Neue Arzneimittel und Medizinprodukte der Risikoklassen II b und III, sowie In-vitro-Diagnostika sollen bezüglich ihres Nutzens einheitlich bewertet werden.
Wenn man bedenkt, dass Großbritannien sich anschickt, die Europäische Union zu verlassen und dass starke nationale politische Strömungen in Frankreich, Polen, Ungarn und Griechenland, aber auch in Holland und Deutschland dazu führen, dass populistisch orientierte Parteien reichlich europaskeptische oder gar ausstiegswillige Wählerstimmen gewinnen, dann muss man ins Grübeln verfallen. Ist gerade diese Kommissionsidee geeignet ist, ein proeuropäisches Feuer zu entfachen? Der Verlust nationaler Autonomie zu Gunsten von Europa wird bekanntlich zunehmend kritisch gesehen.
Vom Sinn und Unsinn der Nutzenbewertung auf nationaler Ebene
Rein fachlich liegt die Kommission nicht falsch, wenn sie angesichts großer Unterschiedlichkeiten in den Gesundheitssystemen des europäischen Marktes auf mehr Einheitlichkeit drängt. Aber in der Verwirklichung der Nutzenbewertungsidee hängt viel davon ab, welche Ausrichtung der jeweilige methodische Ansatz hat. Schweden, die Niederlande und insbesondere England richten die Nutzenbewertung vorwiegend gesundheitsökonomisch aus, während z.B. Frankreich und Deutschland ihre Nutzenbewertung verstärkt an medizinisch relevanten Ergebnissen orientieren.
Hinzu kommt, dass es einen deutlichen Unterschied ausmacht, ob – wie in Deutschland – ein neuer Wirkstoff mit der Marktzulassung de facto verordnungsfähig ist, während vielerorts in Europa erst nach einer Einigung über den Preis die Patienten einen Zugang zu der Arzneimittelneuheit erhalten. Andererseits haben viele EU-Statten haben aus wirtschaftlichen Gründen keine Kapazitäten zu einer systematischen nationalen Nutzenbewertung. Bei Medizinprodukten und Diagnostika ist alles noch verwirrender.
Wer als Arzt oder Wissenschaftler in multinationalen Advisory boards in Europa häufiger zu tun hat, merkt sehr schnell, wie zum Beispiel der Arzneimittelnutzen im Detail recht unterschiedlich bewertet werden kann, obwohl überall mit der gleichen HTA-Technik gearbeitet wird. Wobei man immer wieder erfahren wird, dass das methodisch sehr stringente Verfahren des Gemeinsamen Bundesausschusses mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) in der frühen Nutzenbewertung gerne nachgelesen, aber keineswegs anderorts 1:1 umgesetzt wird.
So halten z.B. Experten aus Spanien und Frankreich die Subgruppenfiligranisierung in Deutschland für gelegentlich überzogen. Das Nichtakzeptieren des Endpunktes PFS (progression–free survival) und der indirekten Studienvergleiche wird andernorts in Europa positiver gewichtet. Und über die Akzeptanz des Nutzens von Studienergebnissen aus Surrogatendpunkten gibt es keineswegs ein einheitliches europäisches Meinungsbild.
Eine europäische Nutzenbewertung darf die derzeit hohen deutschen Qualitätsstandards in der gesundheitlichen Versorgung nicht senken
Mit ihrem Vorstoß zur Vereinheitlichung der Nutzenbewertung beabsichtigt die Kommission nach eigener Aussage nicht, wirtschaftliche, soziale oder ethische Aspekte in die Bewertung einzubeziehen. Und man wolle sich auch in die Preisbildung nicht einmischen. Es bleibe den Mitgliedsstaaten überlassen, den „Mehrwert einer Gesundheitstechnologie abzuschätzen und die für ihr jeweiliges Gesundheitssystem relevanten Entscheidungen zu treffen.“ Aber: Papier ist geduldig und außerdem ist das die Rechtslage.
Aus deutscher Sicht ist zu befürchten, dass mit dem geplanten europäischen Bewertungseintopf ein deutlich dünneres Süppchen gekocht werden wird, als die schwere Kost, die durch IQWIG und G-BA zur Zeit zubereitet wird. Die auffallend positiven Stimmen aus der Pharmaindustrie zu dem Vorstoß der Kommission signalisieren, welche Hoffnungen man an dieser Stelle hegt. Der Lernprozess im AMNOG-Verfahren ist noch längst nicht abgeschlossen, wenn man berechtigte Kritiken am dogmatischen Festhalten in Fragen zweckmäßiger Vergleichstherapien, mancher Endpunktinakzeptanzen oder dem Zurückweisen von indirekten Vergleichen, relevanten Surrogatergebnissen und Rückschlüssen aus RWD (real world datas) ernstnimmt.
Die Sorge des unparteiischen Vorsitzenden des G-BA, Professor Hecken, ist schwergewichtig: Der europäische Regelungsvorstoß birgt die Gefahr in sich, dass unsere hohe Versorgungsqualität leidet.
Angesichts der Verdrossenheit vieler Bürger mit dem keineswegs so stabilen Projekt „Europäische Union“, das wir so dringend benötigen, ist die Kommission gut beraten, vor der „Directive 2011/24/EU“ zunächst dafür Sorge zu tragen, dass der HTA-Qualitätslevel in der Nutzenbewertung überall da angehoben wird, wo die Defizite am deutlichsten sind. Eine Niveauabsenkung braucht niemand. Auch Thomas Kaiser aus dem IQWIG in Köln hat bereits im Herbst 2017 darauf hingewiesen, dass die Europäische Kommission in einem „Reflection Paper“ für Studien nach der Zulassung eine Tendenz zur „Absenkung der Anforderungen“ signalisiert hat.
Wirtschaftsförderung und wissenschaftliche Nutzenbewertung (HTA) sind jedoch bekanntlich zweierlei – vor allem dann, wenn die Beleglage für ein neues Produkt kaum belastbare Studienergebnisse vorzeigen kann.