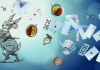Es läuft nicht gut in Sachen DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen), das kann man wohl ohne Umschweife sagen. Als mit der Einfühung des Digitale-Versorgung-Gesetz Anfang 2020 die Möglichkeit geschaffen wurde, Apps auf Rezept zu verschreiben, blickten andere Länder neidisch auf Deutschland. Außerdem rückte die Bundesrepublik, die in Ländervergleichen bisher immer auf den hintersten Plätzen herumdümpelte, mit einem Schlag auf in die vorderste Reihe. So viel zur Theorie, doch die Praxis sieht ganz anders aus:
Betreut vom Bundesamt für Arzneimittelsicherheit (BfArM) wurde ein Verzeichnis erstellt, in das die DiGA auf Zeit oder langfristig aufgenommen werden konnten, sofern sie eine entsprechende Zertifizierung erhielten. Inzwischen sind 33 DiGA aufgenommen. Davon haben die meisten, drei Viertel, der Anwendungen die dauerhafte Aufnahme des BfArM-Verzeichnisses noch nicht geschafft und wurden nur vorläufig gelistet. Der Grund: Sie haben innerhalb eines Jahres noch keine positiven Versorgungseffekte nachgewiesen.
Angekommen sind die DiGA also im deutschen Gesundheitswesen noch nicht. Noch immer sind viele Ärzt:innen bei der Verschreibung zurückhaltend, doch immerhin gibt es einen Aufwärtstrend. Das zeigt ein Bericht zum Zeitraum 1.9.2020 bis 30.9.2021, den der GKV-Spitzenverband veröffentlicht hat. Darin wird eine erste Bilanz zur Inanspruchnahme und Entwicklung der Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen gezogen. Insgesamt wurden in dem Berichtszeitraum rund 50.000 DiGA ärztlich verordnet oder von den Krankenkassen genehmigt. Allerdings wurden davon lediglich knapp 80 Prozent aktiviert.
DiGA: Schnittstellenproblematik
„Der Bericht zeigt: Bei den DiGA ist nicht all Gold, was glänzt. Obwohl der Gesetzgeber mit einem großen Vertrauensvorschuss den Herstellern maximalen Freiraum geschaffen hat, um Produkte auf den Markt zu bringen, die die Versorgung der Versicherten maßgeblich verbessern, konnten die Erwartungen bisher kaum erfüllt werden“, sagt Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband, in einer Pressemitteilung. Die gesetzlichen Bedingungen, unter denen die DiGA in den gesetzlichen Leistungskatalog integriert sind, legten zu wenig Wert auf den positiven Versorgungsnutzen für die Patient:innen, außerdem führten sie zu überhöhten Preisen, kritisierte der Verband und fordert ein Update der Gesetzeslage.
Sollte dieser Fall auch nicht greifen und geeignete Schnittstellen liegen nicht vor, müssen die DiGA andere offengelegte und dokumentierte Schnittstellen unterstützen, die entweder im IOP-Verzeichnis gelistet sind oder für die vom Hersteller ein entsprechender Antrag gestellt wurde. Nehmen Hersteller eigene Profilierungen vor, sind sie verpflichtet, diese in einem anerkannten Verzeichnis zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichungspflicht gilt für geeignete Plattformen, die für eine gewisse Qualitätssicherung sorgen. Es handelt sich demnach um eine Regelungskaskade (vom 01.10.2021), die auch jede DiGA betrifft, die vorher schon nach der alten Regelung eine andere Schnittstelle implementiert hatten. Langfristiges Ziel des Gesetzgebers ist die frei kombinierbare Nutzung von Geräten.
Dennoch rechnen Experten damit, dass sich die Apps langfristig durchsetzen werden. Darauf zielt auch die gesetzliche Regulatorik ab, die DiGA mit hohen Anwenderzahlen im Blick hat. Darüber hinaus macht sie den Herstellern klare Vorschriften, wenn es um die Anbindung der DiGA an andere medizinische Geräte geht. Dazu müssen Hersteller entsprechende Schnittstellen zur Verfügung stellen – eine Vorschrift, die viele Unternehmen nicht so ganz schmeckt, weil sie erfahrungsgemäß aus Wettbewerbsgründen häufig zögern, Daten herauszugeben – und das gilt auch für Schnittstellen.
Hohe Validierungshürden für Hersteller
Eine weitere Beobachtung ist, dass die meisten gelisteten DiGA nicht zur Behandlung der sogenannten Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes dienen, vielmehr sind es die Bereiche Mental Health, bei der sich Therapieerfolge durch die Anwendung einer DiGA erzielen lassen. Doch woran liegt es, dass es weniger langfristig gelistete Anwendungen gibt? Ein Grund dafür liegt in den hohen Hürden, die eine DiGA überwinden muss, um in das BfArM-Verzeichnis aufgenommen zu werden. Das Bundesamt hatte in den letzten Monaten die Anforderungen noch einmal verschärft. Das bewegt Hersteller nicht selten dazu, auf privat verkäufliche Gesundheitsapps zu setzen, anstatt auf die rezeptierbaren.
Hinzu kommt, dass die Therapiehoheit immer noch bei den Ärzt:innen liegt und diese bei der Verschreibung von DiGA immer noch zögern, weil sie sich digital überfordert fühlen.
Und ein weiteres Problem stellt sich für die Hersteller: Der Validierungsdruck für die DiGAs ist hoch. Geht es bei einer App z.B. nur darum, die Gesundheitskompetenz oder die Adhärenz zu erhöhen, muss dies auch validiert werden. In der Regel erfolgt das mittels Fragebögen, die z. Teil auch schon vorhanden sind, allerdings gibt es diese für den Hypertonie-Bereich nur auf Englisch.
Sorgen die Unternehmen für eine Übersetzung oder werden die Fragebögen anders angepasst, müssen diese wieder validiert werden. Diese und andere Faktoren verkomplizieren das Verfahren und erhöhen die Entwicklungskosten für die DiGA enorm. Wieder einspielen können die Hersteller diese Kosten nur, wenn sie die Anwendungen über die Masse an die Patient:innen bringen. Aber auch hier gibt es Hindernisse, denn das Bekanntmachen über die Ärzt:innen kostet wiederum und ist aufwendig. Eine Alternative, auf den sich die Unternehmen einstellen sollten, ist Patient:innen mit ihren Produkten so vertraut zu machen, dass diese die Verordnung bei den Ärzt:innen einfordern. Hier sehen Experten einen vielversprechenden Weg für die künftige Vermarktung von DiGA.
Das könnte Sie auch interessieren: