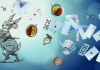In diesem Beitrag erfahren Sie:
- Warum das Fast-Track-Verfahren verbessert werden muss
- Was passieren muss, damit DiGA erfolgreich werden
- Was die Politik tun kann
- Warum alle Beteiligten über Erwartungen sprechen müssen
- Wie DiGA für Hersteller rentabel werden können
Health Relations: Wie stehen Sie als Pharmaunternehmen zu dem Thema DiGA: Sind es nur nette Spielereien oder haben sie doch einen tatsächlichen Nutzen?
Stefan Rabe: Ich bin immer wieder überrascht, wie hartnäckig sich solche Vorurteile halten. Es gibt wohl keinen Versorgungsbereich neben den Arzneimitteln, der so von Evidenz geprägt ist wie die Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Jede DiGA ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, das der nationalen HTA-Behörde belastbare Unterlagen zu positiven Versorgungseffekten oder medizinischem Nutzen vorgelegt und IT-Sicherheit und Qualitätsmanagement nachgewiesen hat.
„Es gibt wohl keinen Versorgungsbereich neben den Arzneimitteln, der so von Evidenz geprägt ist wie die Digitalen Gesundheitsanwendungen.“
Health Relations: Und wie sehen Sie das Thema bei Ihnen im Unternehmen?
Stefan Rabe: Wir bei MSD sind überzeugt, dass Digitale Gesundheitsanwendungen einen wichtigen Beitrag zu einer effizienteren Versorgung und frühzeitigere, zielgerichtetere Interventionen leisten können. Das bedeutet nicht, dass wir selbst Anbieter Digitaler Gesundheitsanwendungen sein wollen. Partnerschaften ermöglichen es, Know-how bestmöglich zu bündeln: Gemeinsam mit einem finnischen IT-Unternehmen unterstützen wir beispielsweise die Zulassung einer DiGA, die Patient:innen zur Mitwirkung an der eigenen Krebsbehandlung befähigt und so zur Sicherung eines optimalen Behandlungsstandards beiträgt.
Health Relations: Eingeführt wurden die DiGA mit dem Fast-Track-Verfahren. War das Ihrer Meinung nach richtig?
Stefan Rabe: Der Idee des Fast-Track-Verfahrens liegt die richtige Analyse zugrunde, dass sich gerade Start-ups im Bereich digitaler Medizinprodukte einer langen Durststrecke zwischen Produktentwicklung und Markteintritt gegenübersehen. Und genau in diese Phase fallen zusätzlich hohe Kosten für Studien und Zertifizierungsprozesse. Allerdings stellt sich die Frage, ob das Verfahren dieser Rolle derzeit gerecht wird. Wir sehen, dass die Schiedsstelle nur randomisierte kontrollierte Studien als Grundlage für höhere Nutzenkategorien akzeptiert. Die Studienplanung und Rekrutierung sind jedoch aufwändig, eine Verlängerung des Erprobungszeitraumes um weitere zwölf Monate ist die Regel. Das führt zu ersten Marktaustritten, um den Antrag auf dauerhafte Listung neu austarieren zu können – und trägt auf der anderen Seite nicht zur Akzeptanz bei Patient:innen, den Behandler:innen und Kostenträgern bei.
„Der Blick nach Frankreich zeigt, dass es beim Fast-Trakc-Verfahren auch anders geht: Da die DiGA bereits vor der Zulassung zum Fast-Track-Verfahren Funktion und Sicherheit nachgewiesen haben, sind alle Risikoklassen für die Erstattung zugelassen.“
Mit Blick auf das Potential KI-gestützter personalisierter Therapiebegleitung ist es außerdem wichtig, dass der Fast-Track uns nicht dauerhaft auf niedrige Risikoklassen des Medizinprodukterechts limitieren darf. Gegenwärtig erlaubt das Fast-Track-Verfahren nicht, Apps höherer Risikoklassen als DiGA einzuführen – es gibt aber auch keinen anderen Weg, sie auf den Markt zu bringen. Ein konkretes Beispiel, was problematisch werden könnte: Wir unterstützen derzeit einen Kooperationspartner dabei, eine App zu entwickeln, in der ein Algorithmus anhand patientenberichteter Signale ständig den zu erwartenden Therapieverlauf bewertet. Ist eine Verschlechterung zu erkennen, geht ein Hinweis an das medizinische Personal, damit es frühzeitig die Behandlung anpassen kann. Der Blick nach Frankreich zeigt, dass es auch anders geht: Da die DiGA bereits vor der Zulassung zum Fast-Track-Verfahren Funktion und Sicherheit nachgewiesen haben, sind alle Risikoklassen für die Erstattung zugelassen.
Health Relations: In Sachen Fast-Track-Verfahren gibt es also Verbesserungsbedarf. Aber betrachten wir einmal DiGA allgemein. Was würden Sie sagen, auf welchem Stand sind wir heute?
Stefan Rabe: Seit Jahresbeginn stagnieren die Neuaufnahmen in das DiGA-Verzeichnis, es gab erste Marktaustritte. Aber das halte ich für normale Anpassungsprozesse in einem sehr jungen Markt mit noch sehr volatilem regulatorischen Umfeld. Man muss sich nur einmal anschauen, wie sich die Anforderungen des Gesetzgebers an IT-Sicherheit verschärft haben oder sich der Blick des BfArM auf geeignete Studienplanungen verändert hat.
Gleichzeitig hat vieles von dem, was DiGA heute schon können, noch gar keinen Eingang in die Versorgung gefunden. Die Ablage von DiGA-spezifischen, medizinischen Informationsobjekten in die elektronische Patientenakte (ePA) kommt erst noch. Die ePA selbst muss erst einmal in der Breite ankommen. Hier würde ich mir mehr Geduld wünschen, anstatt schon jetzt ein neues, nutzungsbasiertes Erstattungsmodell einzuführen. Was so logisch klingt, wirft erhebliche datenschutzrechtliche Fragen auf: Will ich Dritten offenbaren, wann und wie lange ich eine Mental-Health-App genutzt habe? Und wenn wir DiGA bekommen, die das Nutzerverhalten so optimieren, dass möglichst viel abgerechnet werden kann, anstatt den oder die Patient: in den Mittelpunkt zu stellen, verschenken wir eine große Chance für bessere Therapiererfolge.
Health Relations: Was muss als Nächstes passieren, damit es eben zu diesen Therapeierfolgen kommt?
Stefan Rabe: Ein großes Problem, dass die DiGA mit anderen Anwendungen im digitalen Gesundheitswesen teilen, ist eine mangelnde Vernetzung und fehlende Schnittstellen. Aber es ist doch geradezu absurd, dass wir zugelassenen, zertifizierten Apps trotz Einwilligung der Patient:innen verbieten, ärztlich validierte Daten aus der ePA auszulesen und stattdessen erwarten, dass die Nutzer:innen diese händisch übertragen! Und es ist schlicht nicht erklärbar, dass DiGA keine Möglichkeit haben, über zertifizierte Schnittstellen direkt mit den Behandler:innen zu kommunizieren, sondern eine Datenauswertung erst erfolgen kann, wenn die Patient:innen wieder physisch in der Praxis sind oder sich die Ärztinnen und Ärzte für jede DiGA an einem eigenen Onlineportal angemeldet haben.
Health Relations: Was kann die Politik tun?
Stefan Rabe: Vor diesem Hintergrund ist sehr zu begrüßen, dass das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) jüngst vorschlagen hat, den E-Rezept-Fachdienst mit vielen weiteren Anwendungen der Telematikinfrastruktur und auch den DiGA zu verknüpfen. Dies gilt es schnellstmöglich für alle Bausteine des digitalen Gesundheitswesens umzusetzen. Mit Blick auf die Ambitionen der großen internationalen Tech-Konzerne – Apple hat jüngst die Erfassung von Medikation dem hauseigenen Health Kit hinzugefügt – bleibt dafür nicht mehr viel Zeit, wenn wir europäische Lösungen in einem sicheren Gesundheitsdatenraum verfolgen wollen.
„Es gibt erhebLiche datenschutzrechtliche Fragen.“
Wir müssen aber gleichzeitig mit den Patient:innen , den Ärzt:innen und den Gesundheitsfachberufen offen über Erwartungen, Prozessoptimierung und Grenzen digitaler Echtzeitversorgung sprechen. Die Herausforderung ist, wichtige Signale vom Grundrauschen zu trennen und die eilige Nachfrage von der unkritischen Anforderung des Folgerezeptes zu unterscheiden. Hier kann der angekündigte Strategieprozess des BMG ein guter Anker für den Dialog sein.
Health Relations: Die einen sagen, das Evidenzverfahren ist zu kompliziert. Die anderen kritisieren, dass die Entwicklungskosten durch das Aufnahmeverfahren in das DiGA-Verzeichnis zu hoch sind. Wo sehen Sie noch die größten Hürden, damit die DiGA endlich in die Regelversorgung kommen?
Stefan Rabe: Beides ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Wir sollten uns schon die Frage stellen, ob wir bei DiGA niedriger Risikoklassen für angemessene Erstattungsbeträge stets den medizinischen Nutzen sehen müssen und damit den Goldstandard mit randomisierten kontrollierten Studien aufrufen oder ob wir hier nicht das Wirtschaftlichkeitsgebot aus den Augen verlieren und Preise künstlich nach oben treiben. Es spricht Bände, dass gegenwärtig 97 Prozent aller DiGA medizinischen Nutzen anstelle von Verfahrens- und Strukturverbesserungen nachweisen wollen.
Aber entscheidend für den Erfolg der DiGA ist die Perspektive der Behandler:innen. Die zentralen Bedarfe der Ärzteschaft und der Gesundheitsfachberufe haben wir weder angemessen erhoben noch in den Spezifikationen abgebildet. Wir haben es versäumt, DiGA von Anfang an als digitalen Baustein eines integrierten Behandlungspfades zu denken. Das merkt man beispielsweise daran, dass wir keine Verordnungsmöglichkeit für DiGA im Krankenhausbereich haben. Aber gerade am Sektorenübergang könnten DiGA großes Potential in der Nachsorge entfalten. Auch ein Blick auf die Abrechnungsziffern im ambulanten Bereich spricht Bände. Wenn überhaupt vorgesehen, ist die Verlaufskontrolle in der Regel auf ein bis zwei Termine begrenzt, und zwar pro Behandlungsfall, nicht pro Verordnungszeitraum.
„Wir haben es versäumt, DiGA von Anfang an als digitalen Baustein eines integrierten Behandlungspfades zu denken. Das merkt man beispielsweise daran, dass wir keine Verordnungsmöglichkeit für DiGA im Krankenhausbereich haben.“
Health Relations: Und was muss passieren, damit DiGA für Hersteller rentabel werden?
Stefan Rabe: Wie bei allen digitalen Angeboten ist die Skalierbarkeit Dreh- und Angelpunkt. Das bedeutet, dass Hersteller vor allem Angebote machen müssen, die durch ihren Mehrwert und ihre Prozessintelligenz Patientinnen und Patienten als Pull- und die Ärzteschaft als Push-Faktor gleichermaßen überzeugen. Mit Blick auf Europa sehen wir gerade, dass das Vorbild des deutschen Fast-Tracks in der Praxis zu nationaler Fragmentierung führt. Wenn wir für jeden nationalen Markt eine eigene Studie fordern, dürfen wir uns sich nicht über hohe Herstellerkosten und einen trägen Innovationszyklus wundern. Wir brauchen aus meiner Sicht einen europäischen DiGA-HTA-Prozess, der einmalig Evidenz generiert. So haben wir zusammen mit dem Vorschlag eines Europäischen Gesundheitsdatenraumes die einmalige Chance, einen gemeinsamen Markt für evidenzbasierte und sichere Gesundheitsanwendungen zu entwickeln.
Dabei muss gar nicht jede DiGA am Ende des Tages ein gewinnorientierter Business Case sein. Gerade aus der Selbsthilfe heraus könnten sehr gute patientenzentrierte Versorgungsverbesserungen und Therapiebegleiter entstehen. Richtigerweise sieht die DiGA-Rahmenvereinbarung gerade für solche Konstellationen eine Bagatellgrenze für Preisverhandlungen vor. Es bleiben natürlich die Entwicklungs- und Zulassungskosten. Wir als Unternehmen unterstützen solche Innovationen im Rahmen unseres MSD Gesundheitspreises. Es wäre zu wünschen, dass es alsbald auch über Einzelinitiativen hinaus einen Fonds zur Begleitung entsprechender DiGA gibt.
Kennen Sie schon unser Whitepaper rund ums Thema DIGA?